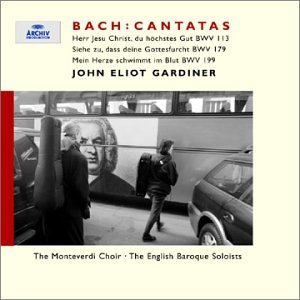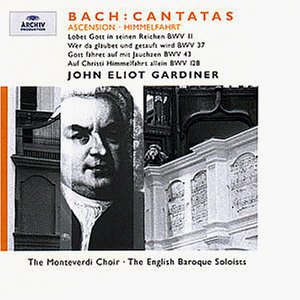Hallo,
nach langer Zeit nun meine Rezension von SDG 153, Vol. 20 / Aufführungsort: Grote Kerk, Naarden-Holland am 20.02.2000 und Southwell Minster, Nottinghamshire – England, am 27.2.2000.

Cover: SDG 153 Vol. 20
C D – eins –
Cantatas for Septuagesimae (4. Sonntag nach Epiphanias)
BWV 144 – Nimm, was dein ist, und gehe hin
BWV 84 – Ich bin vergnügt mit meinem Glücke
BWV 92 – Ich hab in Gottes Herz und Sinn
(Aufführung: am 20.02. 2000 in Grote Kerk, Naarden-Holland)
Soloists: Miah Persson, Sopran | Wilke te Brummelstroete, Alt
James Oxley, Tenor | Jonathan Brown, Bass
———————————————————

Foto: Grote Kerk, Naarden-Holland
—————————————————————————–
- CD-Bestellung über amazon.uk
- CD-Bestellung über amazon.de über meine Partnerseite:
——————————————————————————-
Rezension CD – e i n s :
Kantate: BWV 144 – Nimm, was dein ist, und gehe hin
(Kantate 4. Sonntag nach Epiphanias – Septuagesimae)
Die Kantate entstammt dem ersten Leipziger Amtsjahr Bach’s und erlebte am 6. Februar 1724 ihre erste Aufführung. Ihre Echtheit ist zuweilen angezweifelt worden, – jedoch zu Unrecht; denn das originale Quellenmaterial erweist Bach’s Autorenschaft eindeutig. Bach seine Komposition verzichtet weitgehend auf das konzertante Element. Der Eingangssatz ist eine Motettenfuge mit colla parte geführten Instrumenten – 2 Oboen und Streicher – und teilweise selbständigem Continuo.*)
Wie aus dem Nichts – ohne das geringste instrumentale Vorspiel – schleudern die Tenorstimmen das Motto: „Nimm was dein ist, und gehe hin“ – hervor bevor der Beginn einer fugierten Motette, in der zwei Oboen und Streicher über einen teilweisen unabhängigen Basso continuo die Gesangslinien verdoppeln. Dann, eine traurige und eine zarte Alt-Arie von Wilke te Brummelstroete. Hervorragend interpretiert sie diesen immer wieder in der Kantate zu hören Text: „Nimm, was dein ist….“
Miah Persson (Sopran) interpretiert die Gefühle sehr schön. Sie nutzt geschickt die Nuancen aus – die betörend klingende Oboe im Dialog mit der Stimme verleiht der Arie einen zurückhaltenden und doch elegischen Glanz. Ebenfalls Glanzlichter setzt der Chor in Satz 3 und sechs und verleiht dieser Kantateneinspielung das Prädikat: wunderbar….!!
Kantate: BWV 84 – Ich bin vergnügt mit meinem Glücke
Bach hat den Text höchstwahrscheinlich zum 9. Februar 1727 komponiert. Die Bestimmung der Bach’schen Komposition für eine einzige Solostimme, zu der nur im Schlusschoral der Chor hinzutritt, hat ihr die bei Bach sonst seltene Bezeichnung „Cantata“ eingebracht. Man hat aus dieser Solobesetzung sowie aus der bereits erwähnten Umdichtung darauf schließen wollen, dass es sich bei diesem Werk nur um eine geistliche Hausmusik Bach’s, etwa für Anna Magdalena Bach, handele – gewiss zu Unrecht, wie schon die Bestimmung für den Sonntag Septuagesimae erkennen lässt.
Der aktuell zu vertonende Text, der auf Bachs Schreibtisch lag, basiert ebenfalls auf dem Gleichnis vom Weinberg, auch wenn diesmal nicht von den missgestimmten Arbeitern die Rede ist, sondern von „Meinem Glücke, das mir der liebe Gott beschert“. Bei der Vertonung hat Bach die geringen aufgewendeten Mittel – zum Solosopran treten als Instrumente eine Oboe, Streicher und Continuo – mit viel Sinn für die sich bietenden Abwechslungsmöglichkeiten eingesetzt. Die Eingangsarie verlangt das volle Instrumentarium. *)
Das BWV 84 beginnt in einer anderen Stimmung, auch wenn im dramatischen Kontex sich eine gleiche Richtung abzeichnet wie in der vorhergehende Kantate. Der Dialog zwischen dem Sopran und Oboe, mit beseelt aufspielenden Streichern begleitet, nimmt hier einen anderen und weniger unterwürfigen Ton an. Das ist ein Werk für Solo-Sopran, und Miah Persson gelingt es, eine große emotionale Bandbreite zu nutzen, das Highlight ist die Arie „Ich esse mit Freuden mein weniges Brot“. Dann, nach diesen Wirren – bietet der letzte A-cappella-Choral, diesbezüglich zur Linderung einen sehr geglückten Moment der Ruhe, atemberaubend, wie der Chor das gesanglich meistert.
Kantate: BWV 92 – Ich hab in Gottes Herz und Sinn
Diese neunsätzige Choralkantate, die Bach zum 28. Januar 1725 komponiert hat, liegt Paul Gerhards 12-strophiges Lied (1647) zugrunde. Die ausgedehnte Dichtung mag die Ursache gewesen sein, dass auch die Kantate ungewöhnlich lang geworden ist. Zu Beginn des großangelegten Eingangssatzes konzertieren zwei Oboi d’amore und Streicher im Wechsel. Ihre Thematik ist unabhängig von der Choralweise, die nach Beendigung des Einleitungsritonells vom Sopran zeilenweise in langen Notenwerten vorgetragen wird (Melodie: „Was mein Gott will, das gscheh allzeit). Die übrigen Singstimmen haben keinen Anteil an der Choralthematik, sondern verbinden sich mit den Streichern zu einem thematisch einheitlichen Imitationsgefüge. *)
Die einleitende Choralfantasie ist sorgfältig ausgearbeitet und weist in den drei einander imitierenden tiefen Stimmen heftige Spannungen auf. Instrumental und stimmlich wird dieser Satz in diesem Sinne zu einem wahren Kleinod vorgetragen, genial, wie Gardiner diese Spannungen erzeugt und sie umsetzen lässt und artet in eine perfekte Bach-Interpretation der Einmaligkeit aus.
Der Bass Jonathan Brown überzeugt in der musikalischen Gestalt an Festigkeit und Standhaftigkeit in seinem Rezitativ: „Es kann mir fehlen nimmermehr“. Besonders wirksam sind die Momente, wenn eine körperliche und geistige Auseinandersetzung beschrieben wird, wie wenn die Linien „Mich die Wellen schon ergreifen / und ihre Wut mit mir zum Abgrund eilt “ Diese Verse sind eine Anspielung auf die biblische Geschichte von Jona und dem Wal, dessen Echos sind auch als ein Grollen im Continuo dargestellt“. Auch wenn Brown’s Stimme in den tiefen Lagen für diesen Abschnitt die Subtanz fehlt, sind seine Linien klar und durch intensive Vitalität motiviert gezogen.
Die Tenor-Arie, die durch einen feurigen James Oxley interpretiert wird, ist eine meisterhafte Tirade für die ersten Geigen. Die Atmosphäre, die durch den Text und den instrumentalen Linie erstellt wird, ist eine überzeugende Darstellung – wie die Kraft des starken Armes Gottes seine Einzigartigkeit offenbart und sich als ein unbesiegbares Hindernis gegen den Satan darstellt.
Die Sopran-Arie (Miah Persson) – mit dem „Meinem Hirten bleib ich treu“ ist ein Glanzpunkt an Sangeskunst und in der Instrumentierung. Sie singt so anschaulich und überzeugend von der Treue und wird durch das bejahende Spiel der Oboe und Bc entsprechend beseelend unterstützt. Das berührt und trifft den Hörer im tiefsten seines Inneren und mag ihn vollends überzeugen: „Meinem Hirten bleib ich treu“.

Hörprobe: BWV 92 Sopran-Arie Meinem Hirten bleib ich treu
———————————————————–
C D – zwei –
Cantatas for Sexagesimae
BWV 18 – Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt
BWV 181 – Leichtgesinnte Flattergeister
BWV 126 – Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
(Aufführung: am 27.02.2000 in Southwell Minster, UK)
Soloists: Gillian Keith, Sopran | Angharad Gruffydd Jones, Sopran
Robin Tyson, Alt | James Gilchrist, Tenor | Stephan Loges, Bass
The Monteverdi Choir | The English Baroque Soloists
John Eliot Gardiner
———————————————–
 Foto: Southwell Minster, Nottinghamshire – England
Foto: Southwell Minster, Nottinghamshire – England
—————————————————————
Rezension CD – z w e i :
Gardiner sagt in seinem Reisetagebuch folgendes zu den 3 Kantaten:
Im Brennpunkt aller drei Kantaten steht die überwältigende Macht des Wortes, das (als geistliches Manna vom Himmel) zum Glauben führt, das Thema des Tagesevangeliums (Lukas 8, 4–15), das in den ersten beiden Werken am Beispiel des Gleichnisses vom Sämann behandelt wird. Selbst an seinen eigenen Maßstäben gemessen widmet sich Bach dieser Herausforderung mit ungewöhnlicher Intensität und Findigkeit. Jede dieser Kantaten zeichnet sich aus durch eine lebendige Bildersprache, fesselnde Dramatik und eine Musik von einer Frische und Kraft, die im Gedächtnis haften bleibt.
—————————————————————————–
Kantate: BWV 18 – Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt
Die Entstehung dieser Kantate fällt in Bach’s Weimarer Jahre und ist spätestens zum 24. Februar 1715 anzusetzen, – mit größter Wahrscheinlichkeit aber schon ein oder zwei Jahre vorher. Das Bach zwei Fassungen von dieser Komposition überliefert hat liegt in der unterschiedlichen Musizierpraxis in Weimar und Leipzig. Die Weimarer Fassung verlangt an Instrumenten zum Continuo lediglich 4 Violen, Aufführungstonart war g-Moll, jedoch in der gegenüber dem Kammerton um 1 bis 1 1/2 Ton höheren Chortonstimmung. Wenn Bach das Werk daher in Leipzig in a-Moll aufführte, so entsprach das annähernd der Weimarer Tonhöhe. Neu hinzugefügt wurden in der Leipziger Fassung2 Blockflöten. Dies ist die Fassung, in der sich das Werk in der heutigen Musizierpraxis eingebürgert hat. *)
Dazu Gardiner in seinem Tagebuch zu seiner Aufführungsform von BWV 18:
Als Bach die Kantate 1724 in Leipzig wiederaufführen wollte, ergänzte er dieses Streicherensemble
um zwei Blockflöten, zur Verdopplung der beiden hohen Bratschenstimmen, dem sie einen Nimbus geben, der in gewisser Weise dem 4’-Register einer Pfeifenorgel entspricht. Das war die Version, die wir übernommen und vom Weimarer Chorton in g-moll nach a-moll transponiert haben (die Bratschen sind auf A=465 Hz gestimmt, spielen jedoch nach den ursprünglichen, in g-moll notierten Parts).
—————————————————————
Die Kantate beginnt mit einer betörenden einleitenden Instrumental-Sinfonia. The English Baroque Soloists machen aus dieser Einleitung eine nuancierte und leidenschaftliche thematische Einführung in das Kantaten-Werk. Der Satz drei als Rezitativ und Litanei für Tenor, Bass und Chor ist das Herzstück in diesem Werk. James Gilchrist, (Tenor); Stephan Loges, (Bass); der Monteverdi Choir und das Barockorchester gelingt eine eindrückliche dramatische Litanei -Wiedergabe. Fantastisch, wie hier Gardiner Hand anlegt und seine Protagonisten in der Dramatik und Nuancierung fordert, das ist in sich ein spektakuläre Aufführung geworden die den Hörer begeistert.
Die Sopran-Arie: „Mein Seelenschatz ist Gottes Wort “ erklingt durch Gillian Keith’s mal fröhlich dann zart und als feuriges Bild entsprechend als ein Dankgesang an Gott. Beseelend dazu agiert das stimmlich vorzügliche Orchester.
Kantate: BWV 181 – Leichtgesinnte Flattergeister
Ihre erste Aufführung erlebte die Kantate am 13. Februar 1724. Jedoch scheinen damals noch keine Holzbläser mitgewirkt zu haben; denn die heute vorliegenden Stimmen für je eine Querflöte und Oboe stammen erst von einer wesentlich späteren, nicht sicher datierbaren Wiederaufführung. *)
Mit den „leichtgesinnten Flattergeistern“ sind jene oberflächlichen, wankelmütigen Menschen gemeint. Mann kann nur staunen, wie anschaulich Bach die einzelnen Details des Gleichnisses ausmalt eine zerklüftete Melodieline, von Trillern durchsetzt, eine locker geführte Staccato-Artikulation im tempo vivace und eine Instrumentierung in den oberen Stimmen mit Flöte, Oboe und Violine besetzt.
Gardiner gelingt im Kontrapunkt ein perfektes Spannungsfeld aufzubauen. Der erste beginnt mit einer eindrucksvollen Bass-Arie: Stephan Loges – meisterhaft nutzt er die Triller und Verzierungen, mit denen Bach porträtiert – die „Leichtgesinnten Flattergeister“. Angharad Gruffydd Jones, Sopran; ist im Rezitativ ein zögerliches Singen spürbar: ihr weiches Timbre macht ihre Interpretation nicht ganz überzeugend. Der abschließende Choral ist ein wahrer Festschmaus, mit den triumphierenden Trompeten erzielt das gesamte Ensemble ein erhebendes Finale.
Kantate: BWV 126 – Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
Diese Choralkantate hat J.S. Bach zum 4. Februar 1725 komponiert. Bach hat dem herkömmlichen Instrumentarium von 2 Oboen, Streichern und Continuo im Eingangschor noch eine D-Trompete hinzugefügt , der die nicht ganz leichte Aufgabe zufiel, mit ihrem durch die natürliche Obertonreihe beschränkten Tonumfang in einem a-Moll-Satz eine führenden Rolle zu spielen. Offenbar stand Bach hierfür ein hervorragender Trompeter zur Verfügung. *)
In seiner Form ist der Eingangssatz ein Triumph für die Trompete – überragend spielt Gabriele Cassone der schon in den Neujahrskantaten von 2000 in der Gethsemanekirche, Berlin so überzeugend aufgetreten ist.

Gabriele Cassone-Trompete, Italien
Hier bewundere ich die Auswahl von Gardiner – nur exzellente Spitzen-Trompeter zu verpflichten, bisher haben sie mich in den SDG-Einspielungen immer überzeugen können und so ist es im BWV 126 wiederum gelungen, dass der Hörer mit einem großartigen Trompeter konfrontiert wird, dazu der klasse auftrumpfende Monteverdi Choir ergibt das berühmte Gänsehauterlebnis.

Hörprobe: BWV 126 (Eingangs-Choral) Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
Diese Kantate berauscht mich mit einem Lieblings-Tenor: (James Gilchrist) in Satz 2, 3 und fünf. Das ist Überzeugungsgesang in Wort und Stimme das er so überzeugend darbietet und in einer vollendeten Kunstform so einprägsam dem Hörer vermitteln imstande ist. Leider ist die Oboen-Begleitung etwas Piepsig zu hören aber schmälert nicht den hervorragenden Gesamteindruck.
James Gilchrist, (Tenor); und Robert Tyson, (Alto); interpretieren virtuos das Rezitativ in Satz 3; „Der Menschen Gunst und Macht wird wenig nützen“. Ein Perlengesang vollster Reinheit und Klasse…. ein Traumduo!

Hörprobe: BWV 126 Recitativ für Alt, Tenor Der Menschen Gunst und Macht wird wenig nützen
In Satz vier, Bass-Arie: „Stürze zu Boden, schwülstige Stolze“ ist Stephan Loges ein prächtiger Part gelungen, stimmlich Ausdrucksstark interpretiert er virtuos das „schwülstige Stolze“.
Der Monteverdi Chor ist im Stande, den Schlusschoral mit einer Wärme und Stille – inhaltlich seiner Bedeutung: auf Hoffnung und Frieden in einer wunderbaren Schönkeit und Gerechtigkeit – gesanglich einzuhüllen – das ist es, was ein Weltklasse-Chor so auszeichnet – sie sind immer wieder in der Lage, das wörtliche Geschehen auch stimmlich zu artikulieren und umzusetzen, so dass es ein perfekter Kunstgenuss wird.
Aus Gardiner-Reisetagebuch seine Schlussanmerkung zum BWV 126:
Nichts ist oberflächlich an Bachs Vertonung, an der eindringlichen Bitte um ‚Fried und gut Regiment’ und der zarten Hoffnung auf ‚ein geruh’g und stilles Leben’. Und die denkwürdigste Phrase wird für das drei Takte umfassende ‚Amen’ aufgespart, eine wunderbare Verschmelzung polyphonen Tudorstils mit Bach’schem Kontrapunkt, die unter dem hölzernen Tonnengewölbe des Southwell Minster überirdische Schönheit erlangte.
Mein Schluss-Fazit zu diesen Einspielungen:
Es sind wieder herrliche Kantaten-Einspielungen geworden, die den Vergleich mit den bereits veröffentlichten SDG-CD’s nicht scheuen brauchen. Zu bewundern ist immer wieder die Handschrift von Sir Gardiner, seine Interpretationen der Bachwerke gelingen ihm durchwegs auf allerhöchstem Niveau und dazu sein Weltklasse-Chor und das fantastische Barockorchester ergeben immer wieder ein Spitzenergebnis der Sonderklasse.
—————————-
*) Textauszüge: Alfred Dürr, J.S. Bach “Die Kantaten”
————————–
Gruß
Voker




Gefällt mir Wird geladen …
 .News:
.News:





 Link:
Link: